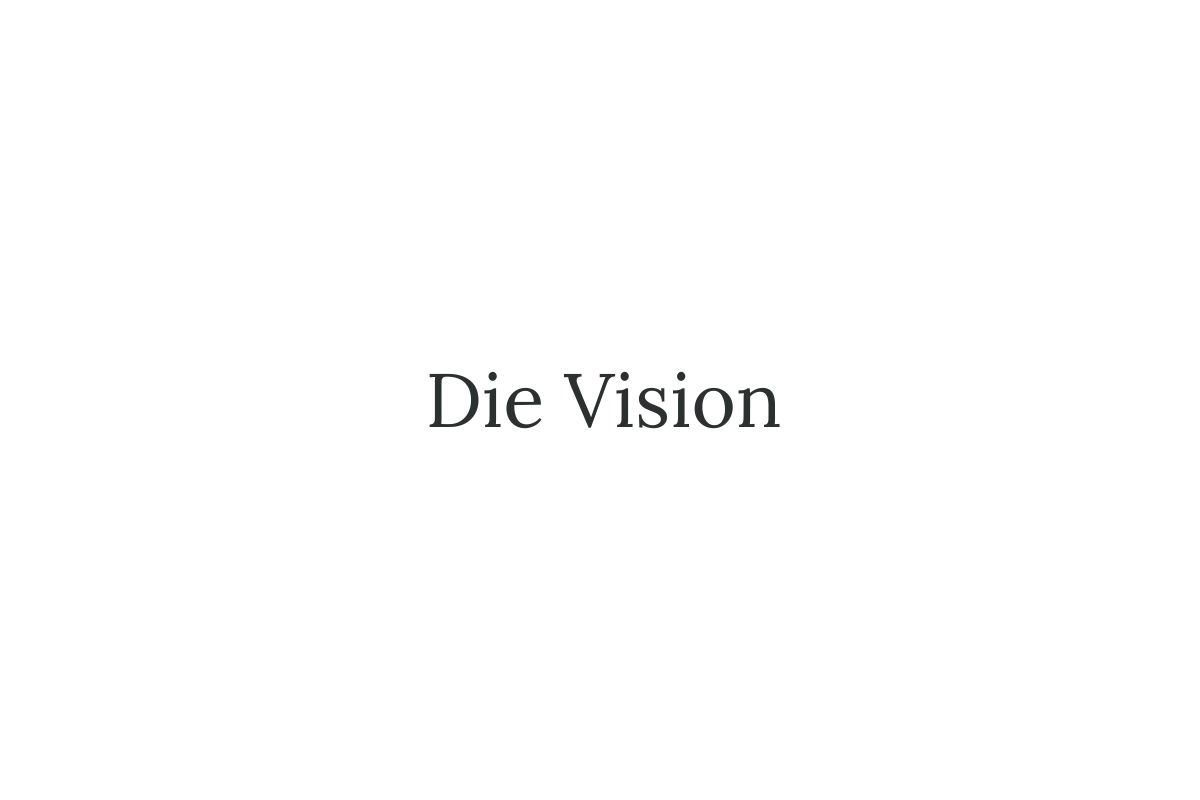
Ihr Kompass in einer komplexen Welt – warum die Vision von Unternehmen Menschen befähigt und psychologisch zur Notwendigkeit wird
Warum die Vision von Unternehmen Orientierung gibt:
Wie jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit nehmen wir uns Zeit, unsere Gedanken mit Ihnen zu teilen. Wir sind heute mehr denn je überzeugt: Eine Vision ist kein „Nice-to-have“, sondern ein essenzielles psychosoziales Werkzeug. Deshalb haben wir im Dezember 2021 unsere Vision nach 10 Jahren neu formuliert:
Menschen befähigen, die Welt im Wandel zu gestalten.
Wir haben die Vision, dass Menschen im stetigen Wandel ihre Veränderungen leicht und nachhaltig gestalten. Dafür unterstützen wir die Entwicklung von Ideenreichtum mit agiler Haltung – um gemeinsam zukunftssicher in einer komplexen Welt zu navigieren.
In diesem Beitrag durchleuchten wir diese Vision – psychologisch, gesellschaftlich und ganz praktisch. Und wir tun es im Gespräch mit Ihnen: Wo erkennen Sie sich wieder? Wo wünschen Sie sich mehr Klarheit, mehr Wirksamkeit, mehr Miteinander?
Der psychologische Anker: Vision von Unternehmen als Sinnstiftung gegen die Unsicherheit
Komplexität verunsichert. Wenn gewohntes Wissen brüchig wird, sucht unser Gehirn nach Orientierung – und zwar nach bedeutungsvoller Orientierung, die kognitive Last senkt und Handeln erleichtert. Genau hier setzt eine starke Vision an: Sie fungiert als innerer Fixpunkt, der disparate Informationen bündelt, Prioritäten klärt und das Gefühl von Kontrollverlust in Bedeutsamkeit verwandelt. In psychologischer Sprache: Eine geteilte Vision bietet einen gemeinsamen Deutungsrahmen und entlastet damit unser begrenztes Aufmerksamkeitsbudget. Sie reduziert nicht die Vielfalt der Welt, aber sie ordnet sie – und macht daraus eine Richtung. Die Formulierung „Menschen befähigen“ verschiebt den Fokus weg von Angst und Defiziten hin zu Kompetenz, Gestaltungswille und gemeinsamer Handlungsfähigkeit. So entsteht Sinn – und Sinn stiftet Halt.
Frage an Sie: In Momenten, in denen vieles gleichzeitig passiert – welche Worte, welche Sätze geben Ihnen Richtung?
Die Funktion des Narrativs: Ein kollektiver Topos der Bewältigung
Menschen erzählen sich Geschichten, um die Welt zu verstehen. Diese narrativen Topoi (gemeinsame Deutungsmuster oder kulturell geteilte Erzählfiguren) sind mehr als Metaphern; sie sind psychologische Werkzeuge, mit denen wir Unsicherheit bewältigen. Fehlt ein positiver Topos, füllt sich das Vakuum oft mit Vereinfachungen, die kurzfristig Klarheit, langfristig aber Spaltung erzeugen. Die Vision „Menschen befähigen“ stiftet einen anderen Plot: Wirkönnen – gemeinsam und lernend – die nächsten klugen Schritte machen. Damit wird „Befähigung“ zum kulturellen Gegennarrativ gegen Ohnmachtserzählungen. Sie lädt zur aktiven Rolle ein („Ich bin beteiligt“), definiert Fortschritt als kooperative Leistung („Wir schaffen das miteinander“) und macht Gestaltung wieder attraktiv („Es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen“). Kurz: Ein tragfähiges Narrativ transformiert Angst in Antrieb – und genau das braucht eine Gesellschaft im Wandel.
Impuls: Wenn Sie „Befähigung“ als Geschichte denken – welche Szene würde den Wendepunkt markieren?
Der Motor des Handelns: Kollektive Wirksamkeit und Partizipation
Motivation ist gut; kollektive Wirksamkeit ist besser. Sozialpsychologische Forschung zeigt, dass Menschen sich vor allem dann engagieren, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:
1. Zugehörigkeit – ich erlebe mich als Teil eines größeren Wir;
2. geteilte Normen – ich weiß, welches Verhalten „richtig“ ist und wofür wir stehen;
3. Wirksamkeitserwartung – ich glaube, dass unser Tun tatsächlich etwas bewirkt.
Die Vision „Menschen befähigen“ zielt genau auf dieses Dreieck. Sie macht Zugehörigkeit anschlussfähig (Befähigung gilt allen Menschen), sie lädt zu klaren, konstruktiven Normen ein (lernen, teilen, iterieren, respektvoll debattieren) und stärkt die Erwartung, gemeinsam Fortschritt zu erzielen – nicht trotz, sondern wegen der Unterschiedlichkeit von Perspektiven. So wird aus Vision Verhalten: Feedback geben, Verantwortung übernehmen, kleine Experimente wagen, Wissen offen teilen. Diese Praktiken erhöhen das Gefühl der Selbst- und Mit-Wirksamkeit – die vielleicht wichtigste Ressource gegen Resignation.
Praktische Frage: Wo könnten Sie in Ihrem Alltag Partizipation um eine kleine Stufe erhöhen. Ein Feedbackritual? Ein offenes Board? Eine 15 Minuten Retro?
Gesellschaftliche Effekte: Von Kohäsion zur systemischen Resilienz
Eine Vision wirkt nicht nur im Individuum, sondern zwischen uns – in Beziehungen, Institutionen, Routinen. Geteilte Zukunftsbilder befördern Kohäsion: gemeinsame Werte, Vertrauen in Prozesse, Bereitschaft zur Mitarbeit. Aus dieser Kultur erwächst Resilienz – die Fähigkeit eines Systems, Störungen aufzunehmen, sich anzupassen und gestärkt daraus hervorzugehen. Drei Mechanismen sind hier zentral:
– Verbindende Werte & Normen: Die Vision artikuliert, wie wir miteinander umgehen wollen (z. B. Transparenz, Respekt, Lernkultur) und schafft damit Orientierung über Einzelfälle hinaus.
– Vertrauen & Verlässlichkeit: Klar kommunizierte Ziele und sichtbare Zwischenergebnisse bauen Vertrauen auf – zwischen Bürger:innen, Organisationen und Verantwortlichen.
– Inklusive Verfahren: Wer mitgestalten darf, trägt mit – und trägt auch in Krisenzeiten. Partizipative Prozesse sind nicht „nice“, sie sind ein Risikopuffer.
Wichtig: Resilienz entsteht nicht durch Homogenität, sondern durch vernetzte Vielfalt – unterschiedliche Kompetenzen, die koordiniert handeln können. Eine Vision, die Befähigung ins Zentrum stellt, macht diese Vielfalt produktiv.
Reflexion: Welche Stimme fehlt in Ihren Projekten regelmäßig – und wie könnten Sie sie konkret einbinden?
Die Vision bekräftigt: Befähigung als Basis der Resilienz
„Menschen befähigen“ ist mehr als ein warmer Satz. Psychologisch bedeutet er: Selbstwirksamkeit in Serie – erlebbar, messbar, wiederholbar. Wer wiederholt erfährt „Wir können das gemeinsam“ (ob in Teams, Quartieren, Netzwerken), überträgt diese Erfahrung auf neue Felder. Aus „können“ wird Können. Aus Haltung wird Routine.
Für die Praxis heißt das:
– Klein anfangen, groß lernen: Iteratives Vorgehen (Bauen–Messen–Lernen) statt Perfektionismus. – Sichtbar machen, was gelingt: Ergebnisse transparent teilen – auch Zwischenschritte.
– Rituale der Reflexion: Regelmäßige, kurze Retrospektiven – Was stärkt? Was hemmt? Was probieren wir als Nächstes?
– Sprache der Befähigung: Fragen wie „Was ist der nächste wirksame Schritt?“ oder „Wen machen wir damit handlungsfähiger?“ richten den Blick auf Wirkung statt auf Rechtfertigung.
So entsteht eine Kultur, die Unsicherheit nicht ausblendet, sondern bearbeitbar macht. Befähigung ist damit keine pädagogische Floskel, sondern die Tragstruktur von Resilienz – im Team wie in der Gesellschaft.
Mini Challenge: Wählen Sie für diese Woche ein Vorhaben, das Sie in zwei überschaubare Experimente aufteilen. Was lernen Sie schneller als bisher?
Fazit und Aufruf zum Dialog
Eine starke Vision ist gleichzeitig Kompass (Sinn), Grammatik (Narrativ) und Antrieb (kollektive Wirksamkeit). Sie verhindert Fragmentierung, indem sie Bedeutung, Beteiligung und Bewegung zusammenbringt. Unsere Erfahrung: Wo Menschen befähigt werden, entsteht Zutrauen – in sich selbst, in andere, in das Gemeinsame. Und dieses Zutrauen ist die vielleicht knappste Ressource unserer Zeit.
Wir möchten den Dialog mit Ihnen fortsetzen. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken zu diesen Fragen:
– Wofür möchten Sie in Ihrem Kontext Menschen konkret befähigen – und woran würden Sie Erfolg erkennen?
– Welche Routinen (Meetings, Kommunikation, Entscheidungen) könnte man mit wenigen Schritten befähigungsorientiert gestalten?
– Wo braucht es mehr Teilhabe – und wie ließe sie sich niederschwellig ermöglichen?
Zum Schluss ein persönlicher Wunsch: Dass wir in Deutschland bald eine klare, geteilte Vision haben, die einen Aufbruch markiert – eine klare und verständliche Vision, die nicht ausschließt, sondern ermutigt; die nicht belehrt, sondern befähigt; die nicht nur sagt, wo wir hinwollen, sondern wie wir gemeinsam dorthin kommen.
💬 Hier geht es zum Gedankenaustausch: LinkedIn